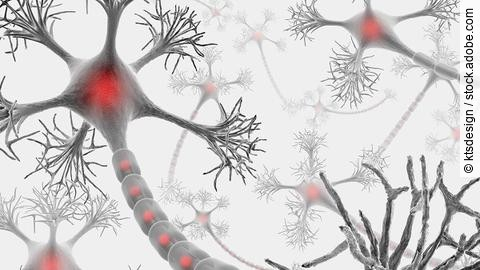Die Asymmetrie des Gehirns ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich stark ausgeprägt.
Obwohl das Gehirn in zwei Hälften geteilt ist, ist es nicht genau spiegelbildlich. Manche Funktionen werden eher auf der linken Seite verarbeitet, andere eher auf der rechten. Wissenschaftler*innen des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften (MPI CBS) und des Forschungszentrums Jülich (FZJ) haben nun gemeinsam mit einem internationalen Team von Neurowissenschaftler*innen herausgefunden, dass die Asymmetrie des Gehirns vererbbar ist - und was wir mit Affen gemeinsam haben.
Das Gehirn ist asymmetrisch
Auf den ersten Blick sieht das Gehirn symmetrisch aus: Es ist in zwei Hälften geteilt, die ungefähr gleich groß sind, und auch die Furchen und Wülste folgen einem ähnlichen Muster. Doch der erste Eindruck trügt. Die verschiedenen Hirnregionen weisen subtile, aber funktionell relevante Unterschiede zwischen der linken und der rechten Seite auf. Die beiden Hemisphären sind auf unterschiedliche Funktionen spezialisiert. So wird beispielsweise die Aufmerksamkeit bei den meisten Menschen überwiegend in der rechten Hemisphäre verarbeitet, die Sprache überwiegend in der linken. Der Grund: Die Arbeit kann besser auf beide Hälften verteilt werden - und das Aufgabenspektrum damit insgesamt erweitert.
Doch diese so genannte Lateralisation, also die Tendenz, dass Hirnregionen Funktionen eher in der linken oder rechten Hirnhälfte verarbeiten, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich ausgeprägt – und zwar nicht nur bei den wenigen, bei denen das Gehirn spiegelverkehrt zu dem der Mehrheit spezialisiert ist. Selbst bei diejenigen, bei denen die Funktionen im Gehirn prinzipiell klassisch angeordnet sind, ist die Asymmetrie unterschiedlich stark ausgeprägt.
Frühere Studien hatten gezeigt, dass sich das wiederum auf die Fähigkeiten selbst auswirken kann. Zu wenig asymmetrisch ausgebildete Sprachareale auf der linken Hirnseite werden zum Beispiel als eine mögliche Ursache für Legasthenie vermutet. Auch bei Krankheiten wie Schizophrenie und Autismus-Spektrum-Störungen oder Hyperaktivität bei Kindern wird mit einer zu schwachen Aufgabenteilung zwischen den beiden Hirnhälften in Zusammenhang gebracht.
Bislang unklar: Welche Unterschiede in der Hirnasymmetrie verschiedener Personen sind vererbbar, welche sind auf unterschiedliche Anforderungen zurückzuführen? Gibt es ähnliche Asymmetrien bereits bei Affen? Wissenschaftler*innen des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften (MPI CBS) und des Forschungszentrums Jülich (FZJ) haben nun untersucht, wie sich Asymmetrien entlang von sogenannten funktionellen Gradienten entwickeln, d. h. entlang von Achsen in der Großhirnrinde an der sich die Hirnfunktionen anordnen.
Asymmetrie des Gehirns teilweise erblich bedingt
Es gibt tatsächlich feine Unterschiede darin, wie Hirnregionen unterschiedlicher Funktionen auf der linken und rechten Seite des Gehirns aufreihen. Auf der linken Seite sind es die Regionen zur Sprachverarbeitung, die sich am weitesten entfernt von denen für Sehen und Wahrnehmung liegen. Auf der rechten Seite befindet sich hingegen das Netzwerk für Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis am weitesten entfernt von den sensorischen Regionen. Zudem zeigte sich, dass die individuellen Unterschiede in dieser Anordnung vererbbar sind. Sie sind damit zum Teil genetisch bedingt. Ein Großteil dieser Asymmetrie im menschlichen Gehirn lässt sich hingegen nicht durch genetische Faktoren erklärt werden. Das könnte wiederum darauf hindeuten, dass der durch die persönliche Erfahrung einer Person, also durch Einflüsse aus ihrer Umwelt, geprägt ist.
Individuelle Umwelterfahrungen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle
Der Vergleich mit Makaken brachte schließlich hervor, dass das Gehirn des Menschen asymmetrischer ist als das von Affen. "Vermutlich ergibt sich die Asymmetrie unseres Gehirns aus genetischen Faktoren und solchen, die sich aus persönlichen Erfahrungen ergeben", erklärt Bin Wan, Doktorand am MPI CBS und Hauptautor der Studie.
Tatsächlich beobachteten die Forscher*innen bei älteren Menschen eine geringere Rechtsasymmetrie. Das Phänomen könnte sich demnach im Laufe des Lebens verändern.
"Wir wollen verstehen, welche Rolle diese feinen Unterschiede zwischen linker und rechter Hemisphäre spielen und wie sie mit den verschiedenen Entwicklungsstörungen zusammenhängen könnten", erklärt auch Sofie Valk, Leiterin der Studie und der Forschungsgruppe Kognitive Neurogenetik am MPI CBS. "Wenn wir verstehen, wie Asymmetrie vererbt wird, lässt sich auch besser einschätzen, welche Bedeutung genetische und umweltbedingte Faktoren generell für dieses Phänomen haben. Vielleicht können wir dann herausfinden, wo etwas schiefläuft, wenn genau dieser Unterschied zwischen links und rechts gestört ist."
Die Forscher*innen untersuchten diese Zusammenhänge anhand von zwei Datenbanken: Eine mit Scans menschlicher Gehirne, darunter auch von Zwillingen, die andere mit Scans von 19 Makaken. Durch den Vergleich eineiiger und zweieiiger Zwillinge und nicht verwandter Personen konnten sie herausfinden, wie sich die beiden Geschwister voneinander unterscheiden – was also genetisch bedingt ist und was durch die Umwelt. Der Vergleich mit Makaken wiederum machte deutlich, wo die Unterschiede zwischen Mensch und Affe liegen und welche davon durch die Evolution entstanden sind. Die Unterschiede selbst berechneten die Wissenschaftler*innen mithilfe der sogenannten niedrigdimensionalen funktionellen Konnektivitätsorganisation des Gehirns. Die gibt Aufschluss darüber, inwieweit die einzelnen Hirnregionen zusammenarbeiten können. Die Forscher*innen berechneten dieses Merkmal zunächst in beiden Hemisphären und errechneten anschließend daraus die Asymmetrie aus der Differenz zwischen links und rechts.
Quelle: Pressemitteilung/Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften